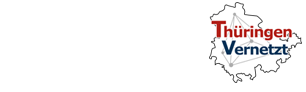Als zu Beginn der 90er Jahre eine große Anzahl Flüchtlinge nach Deutschland kam, um um Asyl zu bitten, war dies für uns als ehemalige DDR-Bürger neu. Gerade auch im ländlichen Bereich, in welchem sich meist keine Begegnungen ergeben, waren nicht selten Abgrenzung und Vorurteile – artikuliert in Halbwissen und Stammtischparolen – auf der kommunikativen Tagesordnung der nunmehr Ostdeutschen.
Für uns als Verein war es eine glückliche Fügung, dass wir recht zeitnah über private Begegnung Kontakte zu Flüchtlingen aus dem Kosovo und Serbien bekamen, die in ihrer Heimat auch dem Fußballspiel nachgegangen waren. Unser Angebot, mit am Training teilzunehmen, wurde von ihnen sehr gern angenommen. Durch unsere Lage ab von den Städten und aufgrund der begrenzten mobilen Möglichkeiten durch den Öffentlichen Nahverkehr regelten wir bereits damals die Fahrten zu den Trainingseinheiten sowie – später nach Klärung aller Formalitäten – auch zu den Punktspielen – per Fahrdiensten und Fahrgemeinschaften.
Wir konnten beobachten, wie Menschen aufblühen, die ihrer Leidenschaft nachgehen können – dem Fußballspiel. Wir konnten sehen, wie Trainings- und Spielzeiten zu einer festen Struktur für die Flüchtlinge wurden. Menschen, die sich durch den Verlust der Heimat, dem wie auch immer gearteten Abschied von Familie und Freunden sowie aller Vertrautheit in einer traumatischen und noch dazu unsicheren und scheinbar perspektivlosen Lage befanden, erlebten durch das gemeinsame Fußballspiel Ablenkung, Freude, Bestätigung und körperliche Betätigung zum umfassenden Stressabbau.
Noch dazu ergaben sich wirkliche Begegnungen, von denen nicht nur die Flüchtlinge profitierten. Dass Rassismus auf dem Sportplatz – egal, in welcher Liga – genau wie Homophobie keine Seltenheit ist, ist kein Geheimnis. An dieser Stelle wurde die Integrationsarbeit, die sich für uns ergab und die sich auf der Grundlage von Kontakten immer weiter entwickelte, zu einem festen Bestandteil unserer eigenen Vereinsphilosophie. Aus den Reihen unserer Spieler und Fans gab es zu keiner Zeit rassistische Äußerungen gegenüber den integrierten Flüchtlingen in unserer eigenen Mannschaft, als auch gegenüber Spielern anderer Mannschaften, die einen anderen kulturellen, religiösen oder herkunftsbezogenen Hintergrund haben (könnten). Dies betonen zu müssen als Ausnahme, stellt sehr deutlich die Problematik des alltäglichen Rassismus und seiner allgemeinen Verbreitung auch in unserer Region dar und untermauert die Notwendigkeit zu einer nachdrücklichen Integrationsarbeit im und über den Sport. Nur über Begegnungen erfahren auch wir, unter welchen Bedingungen Menschen in ihrer Heimat lebten und warum bzw. auf welchem beschwerlichen Weg sie diese verlassen mussten. Gerade diese Informationen, diese Gespräche und menschlichen Kontakte sind dazu geeignet, Vorurteile abzubauen und zu entwerten.
Zur persönlichen Geschichte unseres Sportfreundes D.Y. aus Eritrea, Alter:27, derzeit wohnhaft in Altenburg (Gesprächsnotiz aus Kontakten)
Seit dem 23. Mai 2015 liegt uns für D.Y. die Spielgenehmigung vor, die es ermöglicht, ihn im Punktspielbetrieb unserer Liga einzusetzen. Dem voraus gingen einige Wochen der Kontaktaufnahme und des Kennenlernens sowie des gemeinsamen sportlichen Trainings.
D.Y. spielt, so gab er uns schüchtern, aber offen Auskunft, seit seiner Kindheit in Eritrea Fußball – zwischen 2008 und 2010 sogar eingebunden in einer Schulmannschaft. Wenn man die politische Lage und die der Menschen in Eritrea kennt, weiß man um die Bedingungen dieser militarisierten und einschränkenden Gesellschaft, was auch für D.Y. nach Beendigung seiner Schulzeit das fußballerische Aus bedeutete. Trotz allem war er immer interessiert am Fußballsport und kannte auch das deutsche Nationalteam aus dem Fernsehen und aus Zeitschriften.
Ein Vereinsspieler unserer Lumpziger Mannschaft wurde auf D.Y. aufmerksam, als dieser auf einem Altenburger Sportplatz Fußball spielte und sprach ihn an, ob er nicht Interesse habe, den SV Lumpzig kennenzulernen und dort eventuell mit trainieren und spielen wolle. Trotz einiger Unsicherheiten und Ängste nahm D.Y. dieses Angebot an. Eine Fahrgemeinschaft wurde organisiert – und so kam und kommt er zuverlässig jeden Dienstag und Donnerstag mit auf den Lumpziger Sportplatz. Er sagt selbst, dass er sehr glücklich sei über die Möglichkeit seinem Lieblingssport in einer Mannschaft nachgehen zu können. Neben einem Sprachkurs an einem Tag in der Woche halten sich feste terminliche Ziele und auch Kontaktmöglichkeiten in Grenzen – und schon durch das Training und den nun möglichen Spielbetrieb strukturiert sich seine Woche in feste Zeiten und Fixpunkte. D.Y. fühlt sich in der Gemeinschaft aus Trainern und Spielern gut aufgehoben. Auf uns macht er den Eindruck eines schüchternen jungen Mannes in einem sehr jugendlich wirkenden Körper und mit einer verletzlichen Seele. Er hat innerhalb der Mannschaft gerade durch die Fahrgemeinschaft Kontakte gefunden, an denen er sich auch sportlich und mental festhält und orientiert. Es gibt immer wieder Gelegenheit zu Gesprächen und einem Austausch, aber kein Drängen auf das Preisgeben persönlicher Geschichten. Wir können nur vermuten, auf welchem Weg und unter welchen Umständen unser neuer Sportfreund nach Europa kam, wir können nur ansatzweise erahnen, wie allein und fremd man sich hier fühlt – und was man hinter sich haben muss, um dieses Schicksal auf sich zu nehmen. So hofft D.Y., der ohne seine Familie in Altenburg lebt, inständig, in Deutschland bleiben zu können – und dass der Sport in unserem Verein ihm die Kraft und die Unterstützung gibt, die vielleicht dazu beitragen kann. Dies wäre auch unser Wunsch.
Die Flüchtlinge, die in unserer Reihen Fußball spielten und spielen, konnten und können zudem erfahren, dass sie angenommen werden und man interessiert ist, sie kennenzulernen und auch ihre persönliche Geschichte zu hören. Und nicht nur dies: Wir sind keine Therapeuten, aber nach dem Spiel sitzen wir zusammen, essen eine „Thüringer Roster“ und trinken ein (alkoholfreies) Bier, plaudern noch einmal über das Spiel, die genutzten oder verpassten Chancen – aber auch über die eigenen Kinder, die Arbeit, über Freizeitaktivitäten usw. Wir planen zusammen Vereinsabende, besuchen Kinoveranstaltungen wie u.a. im letzten Jahr den Film zur WM, unterstützen das Kinder- und Jugendfest unseres Vereins – und in all dies sind die Flüchtlingen und Zuwanderer, die wir nach einiger Zeit nicht mehr als solche wahrnehmen und die auch zumindest im Sport ein anderes, aufgerichtetes Selbstbild entwickeln, einbezogen.
Über die Jahre hat sich die Integrationsarbeit unseres Vereins aller Widrigkeiten durch – und das muss man ehrlich sagen – finanzielle Einschränkungen zum Trotz stabil gehalten. Schon seit vielen Jahren spielt ein Serbe in unseren Reihen, der einst als Flüchtling nach Deutschland kam. Zu den Spielen bringt er oft seine Söhne mit. Einige Jahre konnten wir einen japanischen Studenten als Spieler in unseren Reihen begrüßen. Noch heute besteht zu ihm ein enger Kontakt und diese Begegnung war ein schönes Beispiel dafür, dass es bei Integration nicht nur um die große Anzahl an Flüchtlinge geht, sondern um Zuwanderer, um Menschen, die auch nur eine Zeitlang bei uns leben. Neben der sportlichen Annäherung und Integration ist zudem ein merklicher Abbau sprachlicher Barrieren durch die gemeinsame sportliche Betätigung und durch die Begegnungen nicht nur für uns spürbar. Diese mündete in der Vergangenheit bereits einige Male auch in einer beruflichen Eingliederung über Praktika und Arbeitsaufnahmen, die sich durch Empfehlung und Vermittlung unserer Vereinsmitglieder ergaben.
Integration muss man wollen – und man muss bereit sein, dafür etwas zu tun. Alle müssen hierbei an einem Strang ziehen, denn es kostet Aufwand, Fahrgemeinschaften zu organisieren, Fahrdienste einzurichten, das Training sprachlich so auszurichten, dass es auch Nicht-Muttersprachler verstehen, alle organisatorischen Schritte zu gehen, bis ein Flüchtling im Verein auch Punktspiele bestreiten darf usw. Aus unserer Erfahrung können wir sagen, dass diese einmal verankerte Grundeinstellung in unserem Verein inzwischen als eine Art kollektives Grundverständnis vererbt wird und als Selbstverständnis weiter geführt wird.